




 [DEUTSCH]
[DEUTSCH]
Schlern
Der Schlern (2.563 m, ital. Sciliar, aus ladin. Sciliër) ist ein Berg in den Dolomiten/Alpen in Südtirol, Italien.
Trotz seiner geringen Höhe gilt der stockartige Westpfeiler der Dolomiten auf Grund seiner charakteristischen Form mit den beiden vorgelagerten Bergspitzen, der Santner- (2.413 m) und derEuringerspitze (2.394 m), als Wahrzeichen Südtirols. Der Schlern trägt selbst eine Hochfläche, deren frühe weidewirtschaftliche Nutzung durch urgeschichtliche Funde bezeugt ist, und überragt die Seiser Alm, die höchstgelegene Hochweide Europas, sowie die Mittelgebirgsterrasse von Kastelruth. Der Burgstall (2.515 m) bildet den Nordrand des Berges, seine höchste Erhebung ist derPetz (2.564 m), der den Gabels Mull (2.390 m) und den Jungschlern (2.280 m) überragt. Auf dem Schlern eröffnete die Sektion Bozen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins am 22.August 1885 ein Schutzhaus, das 1903 mit dem daneben stehenden Gasthaus zu den Schlernhäusern vereinigt wurde (heute im Besitz des Club Alpino Italiano). 1969 errichtete die Sektion Bozen des Alpenvereins Südtirol die Schlernbödelehütte. 1974 wurde das umgebende Gebiet zum Naturpark erklärt, heute Teil des Naturparks Schlern-Rosengarten.
Etymologie
Der im 16. Jahrhundert als Schlernkhofl bzw. auf dem Schalern bezeugte Bergname ist vordeutschen Ursprungs und geht vermutlich auf das vorrömische Etym *Sala "Bach, Graben, Kanal" zurück. Bei der mittelalterlichen Eindeutschung des Namens wurde die Grundform mit dem Suffix -en verbunden, dessen e im Bairischen schon früh ausfiel, so dass die Lautung Salérn entstand (Oswald von Wolkenstein schreibt noch Saleren). Wegen Bewahrung der vordeutschen Betonung schrumpfte die erste Silbe schließlich zu Sl-, was zur Lautung Schl- führte. Ursprünglich galt der Name wohl für den Schlerngraben und den Schlernbach; nach ihnen dürfte der Gebirgsstock zunächst Schlernkofel (siehe die Schreibung aus dem 16. Jahrhundert.), dann Schlern genannt worden sein.
Geologie
Das Schlern-Massiv besteht vorwiegend aus Sedimentgesteinen der Mittleren Trias. Die gebankten Dolomite der Rosengarten-Formation und Rosszähne-Formation entstanden zu einem großen Teil an etwa 30 Grad steilen Abhängen einer Karbonatplattform, im zentralen Plattformbereich auch als flachliegende Sedimente. Zwischen der Rosengarten-Formation und der Rosszähne-Formation finden sich Vulkanite, die im Ladinium entstanden sind. Überlagert werden diese Formationen von der Schlernplateau-Formation, die unter anderen von Dolomit- und Kalkbänken gebildet wird. Die höchsten Teile des Schlernplateaus werden von Gesteinen des Hauptdolomits der Oberen Trias aufgebaut.
Erstbesteigungen
- 1880 Santnerspitze (Ostseite, Schwierigkeitsgrad III.) – Johann Santner allein
- 1884 Euringerspitze (Südwand, III.) – Gustav Euringer und G. Battista Bernhard
- 1908 Jungschlern (Nordkante, III.) – Paul Mayr und Ernst Hofer
- 1912 Burgstall (Ostwanddurchquerung, III.) – Max Reinstaller, Heindl Tomasi
- 1912 Mull (Nordostflanke, II.) – Paul Mayr, Hermann Kofler, Hans Kiene und Pius Wachtler
- 1929 Schlernkind (IV.) – Fidel Bernard, Hans Leitgeb, Georg Harm, Edi Hermann und Luis Gasser

Archäologische und geophysikalische Untersuchungen im Bereich der bronzezeitlichen (Brandopferplatz) und römischen (Heiligtum) Fundstelle "Burgstall" auf dem Schlern (Südtirol, Italien)


Das Bergmassiv des Schlern, 15 km östlich von Bozen, erreicht mit dem Gipfel „Petz“ eine Höhe von 2.563 m NN. Der Schlern ist im Gegensatz zu anderen Dolomitengipfeln von eher sanfter Gestalt, da ihn oberhalb seiner steilen Felsflanken eine plateauartige Gipfelfläche kennzeichnet. Neben einer herausragenden touristischen Bedeutung des Schlerns als Wandergebiet gilt der Schlern heute als Wahrzeichen Südtirols. Um ihn ranken sich zahlreiche Sagen, deren Themen den Berg meist als Ziel von Hexenfahrten und Hexentanzplatz charakterisieren. Es wäre verlockend, in diesen Sagen einen christlichen Reflex auf vorchristliche Bräuche zu sehen, allerdings läßt das häufige Aufgreifen vergleichbarer Thematik an anderen Orten Südtirols in diesen Sagen auch die Verwendung von Topoi annehmen.
Rund 700 m nördlich seines Gipfels befindet sich am Rand steiler Felsabstürze der sog. „Burgstall“, eine natürliche Felserhebung des anstehenden mitteltriadischen Hauptdolomits in 2.515 m NN.

Abb. 1: Blick von der Seiser Alm nach Westen auf den Schlern
Im Sommer 1945 wurde dort bei einer archäologischen Begehung mit anschließender Sondagegrabung ein etwa 50 cm starkes Schichtenpaket aus Asche, kalzinierten Knochen und Keramik angetroffen. Analog zu vielen vergleichbaren Fundstellen konnte der „Burgstall“ als sog. Brandopferplatz angesprochen werden. Grabungen in den Folgejahren ergaben auch römische Funde. In den nächsten Jahrzehnten kam es im Bereich des archäologischen Denkmals immer wieder zu Raubgrabungen.
Leider wurde dabei Stratigraphie nicht hinreichend dokumentiert und Plana offenbar nicht angelegt, so daß heute zum Beispiel unklar blieb, ob die römische Nutzung des Heiligtums auch mit Brandopfern einherging. Bekannt sind solche römischen Brandopferplätze vor allem aus dem nördlichen Alpenvorland – der Forschungsstand zu diesem Thema ist jedoch schlecht. Auch sind Strukturen des Heiligtums, wie Altäre oder eine Einfriedung, nicht bekannt geworden.

Abb. 2: Felserhebung, Stelle des Brandopferplatzes
Die Datierung der Fundstelle ergab sich aus zahlreichen Scherben von Tongefäßen der Laugener Gruppe (Endbronzezeit, Ha A1 bis B1, ca. 1200 bis ca. 900 v. Chr.), sowie ebenfalls gefundenen römischen Münzen (1. und 4. Jh. n. Chr.; jüngstes Stück ist eine Kupfermünze des Valens, 364-378 n. Chr.). Weniger Fundmaterial gehört in die späte Bronzezeit bzw. in die frühe Eisenzeit.
Der Brandopferplatz auf dem Schlern ist forschungsgeschichtlich von erheblicher Bedeutung. Hier gelang es erstmals im Alpenraum nachzuweisen, daß prähistorische Menschen auch solche Hochgebirgslagen in ihren Lebensraum miteinbezogen hatten. Brandopferplätze haben sich zudem in den letzten Jahren als eine wichtige Quelle zu kulturellen Kontinuitäten und Diskontinuitäten herausgestellt, da sie sich auch nach einem Hiatus in ihrer Benutzung wegen ihrer mitunter ausgeprägten Ascheanhäufungen und ihrer nicht selten auffälligen topographischen Lage kulturübergreifend als Kultplatz anboten.
Während die ersten Bearbeiter des Brandopferplatzes „Burgstall“ die anscheinende, aber vielleicht auch nur scheinbare zeitliche Unterbrechung in der Eisenzeit nicht erkannten und ein Tradieren der endbronzezeitlichen Laugener Keramik bis in römische Zeit postulierten, wird heute allgemein neben der vor allem spät- und endbronzezeitlichen Datierung eine erneute sakrale Nutzung des Platzes in der römischen Zeit angenommen. Für die Annahme eines römischen Heiligtums spricht auch der leider nur gerüchteweise überlieferte Fund einer Bronzestatuette (des römischen Gottes Mars?) durch Touristen im Sommer 1966. Die Annahme, dort wäre die feste Architektur eines Tempels oder wenigstens einer Aedicula vorhanden gewesen, wurde geäußert. Es ist allerdings auffällig, daß ein solches Bauwerk vollständig verschwunden wäre, zumal auch nach Einsturz oder mutwilliger Zerstörung noch die Existenz eines Trümmerhaufens o. ä. analog zu verstürzten Almhütten oder auch prähistorischen Hausresten in den Alpen zu erwarten sein dürfte.

Abb. 3: Mit kalzinierten Knochen, Asche und Keramik durchsetzte Oberfläche des Brandopferplatzes
Die mögliche Diskontinuität in der Nutzung als Heiligtum ließ ein Erklärungsmodell zu: In der vorrömischen Eisenzeit könnten dem Burgstall Brandopferplätze zu Füßen des Schlerns den Rang abgelaufen zu haben, wie der des gut erforschten aber schlecht publizierten „Runger Egg“ – dessen Nutzung wiederum mit der römischen Expansion in den Alpenraum endet. Dann erlebt jedoch der Brandopferplatz auf dem Schlern eine Renaissance, die womöglich nur das erste Jahrhundert n. Chr. anhält (Funde der mittleren Kaiserzeit fehlen bislang). Erst in der Spätantike scheint der Platz erneut aufgesucht worden zu sein:
Hypothetisch könnte der Nutzungswechsel in römischer Zeit vom Runger Egg zum rund ein Jahrtausend älteren Brandopferplatz auf dem Schlern mit nativistischen Bestrebungen alteingesessener Bevölkerung erklärt werden. Mit Etablierung einer provinzialrömischen Kultur zum Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. wäre nach bisherigem Wissenstand der Kultplatz außer Funktion, dessen ungeachtet aber nicht aus dem Gedächtnis geraten. Letzteres zeigt der Fund der genannten Münze des 4. Jhs. n. Chr., die als einziges spätantikes Objekt jedoch nicht zuläßt, darüber zu urteilen, ob während der fortschreitenden Christianisierung des Gebietes noch einmal ein alter heiliger Ort von verbliebenen „Heiden“ verstärkt aufgesucht wurde, oder ob vielleicht auch nur ein bei ganz profanen Tätigkeiten verlorenes Geldstück vorliegt.
Während der Kultplatz „Runger Egg“ gut erforscht ist, sind die Erkenntnisse zum möglicherweise korrespondierenden Pendant „Burgstall“ sehr dürftig. Die geplanten Untersuchungen versprechen hier insbesondere durch eine naturwissenschaftlich (14C) und archäologisch datierte Stratigraphie genauere Aussagen bezüglich der zeitlichen Einordnung aller Nutzungsphasen.
Dabei stellt die Erhaltung des Bodendenkmals das größte Problem dar: Durch die Raubgrabungen der 1960er und 1970er Jahre ist die Fundstelle stark gestört worden.
Archäologische und geophysikalische Prospektionen sollen es zudem gestatten, über Änderungen der Gestalt des Heiligtums, aber auch der rituellen Nutzung urteilen zu können. Hierbei sind naturgemäß die Spuren von Opferhandlungen sehr wichtig: Diese finden sich sehr zahlreich in Form von Knochenpartikeln, verkohlten botanischen Resten und Gefäßscherben. Dank der höhenbedingt spärlichen Vegetation ist es aber auch möglich, mit geophysikalischen Methoden größere Strukturen des Heiligtums, wie Wege, Begrenzungen etc., zu finden und aufzuzeigen. Einzelfundeinmessungen sind in diesem Zusammenhang ein wichtiges Instrument, um datierendes Fundmaterial zu geophysikalischen Befunden zu erlangen.
So weit der Forschungsstand vor 2008.
Erste Ergebnisse der Kampagne 2008:
Im August 2008 wurde im Bereich des Burgstalls eine geomagnetische Prospektion durchgeführt. Diese ergab erkennbare Befunde im Randbereich der Streuung calzinierter Tierknochen, die dann in den folgenden drei Wochen mit zwei Sondagen untersucht wurden.




Dabei konnten verfüllte Gruben dokumentiert werden, die erstmalig auf dme Schlern eine genauere Einordnung des Brandopferplatzes erlauben. Die geborgenen Funde sind fast ausschließlich Keramik der Stufe Laugen-Melaun A, die gründliche Prospektion mit einem Metallsuchgerät ergab (neben unendlich viel Müll der 1970er und 1980er Jahre) nur eine römische Münze (Magnentius), einen spätantiken eisernen Stilus und ein vorgeschichtliches bronzenes Ringelchen. Die Funde scheinen damit die bisherige Datierung des Platzes zu bestätigen.
Erst die AMS-14C-Datierungen, die wir im AMS-Labor der Universität Erlangen-Nürnberg durchführen ließen, vermochten dieses Bild zu verändern. Im folgenden ist die Feldzeichnung des Ostprofils eines der Schnitte zu erkennen, zusätzlich eingetragen sind die archäologischen Datierungen (blau) und die AMS-Datierungen (schwarz). Diese zeigen nun das ganze Spektrum der bronzezeitlichen Nutzung des Brandopferplatzes von der Mittleren Bronzezeit bis an deren Ende.

Erste Ergebnisse der Kampagne 2009:
Im Zuge der Kampagne 2009, die den gesamten August dauerte, wurden mehrere Schnitte auf dem Burgstall angelegt. Dabei konnten wesentliche neue Erkenntnisse gewonnen werden. So konnte der Befund 1 aus dem Vorjahr (siehe Profilzeichnung oben) nun eindeutig als Grube erkannt werden. Diese Grube (ca. 1,6 x 2,0 m, 50-60 cm tief) ist mit einer etwa 30 cm starken Packung aus verbrannten Steinen verfüllt, darunter – auf der Grubensohle – befindet sich eine 5-10 cm dicke Schicht von Holzkohle (und zwar Astholz, teilweise in größeren Stücken (bis 40 cm Länge) erhalten, d.h. offensichtlich Feuerholz). Analog zu Parallelen der Urnenfelderzeit nördlich der Alpen deuten wir diesen Befund als Erdofen, dessen Funktion wie folgt vorzustellen ist:
Es wurde die Grube ausgehoben, dann in dieser Grube ein Feuer entfacht. Als dieses gut brannte, wurden Steine daraufgelegt, die in der Folge stark erhitzt wurden. Nachdem das Feuer erstickte, wurde ein Teil der Steine herausgenommen, ein geschlachtetes Tier hineingetan und dann die heißen Steine wieder aufgelegt. Dies alles verschloß man evtl. mit Grassoden und ließ das Tier garen. Um die Grube erneut zu nutzen, mußte man sie wieder ausheben und reinigen – was bedeutet, daß die jetzt vorliegende Holzkohlenschicht von der letztmaligen Nutzung stammt.
Dieser Erdofen „mit Unterhitze“ stammt aus der mittleren Bronzezeit. In der Spätbronzezeit (Laugen-Melaun A) ging man offenbar zu einem anderen Erdofentyp über: Man nutzte die Steinpackung erneut zum Einbringen des zu garenden Tieres, doch entfachte man nun ein Feuer darüber. Die Garzeit ist dabei etwas länger als im zuerst beschriebenen Verfahren, allerdings ist auf der Aufwand der Ofenkonstruktion geringer. Solch einen Erdofen „mit Oberhitze“ verwendete man nach den 14C-Daten bis ins 9. Jh. v. Chr. (also die Stufe Laugen-Melaun B, die sich durch Keramik am Burgstall bislang nicht nachweisen läßt).
Dies ist die Rekonstruktion der Ereignisse, wie sie sich nach den neuen Befunden der Kampagne 2009 darstellen läßt. Insgesamt fanden sich am Burgstall vier Erdofenbefunde, deren Datierung allerdings noch auf die 14C-Analysen wartet. Es gibt zahlreiche ethnologische Parallelen zu solchen Erdöfen; besonders interessant erscheint hierbei, daß bei der bevorzugten Rückenlage der vollständig zu garenden Tiere deren Läufe eventuell bis ins darüber entzündete Feuer ragen können – dies wäre eine mögliche Erklärung für die Dominanz von Extremitätenknochen im Bestand der kalzinierten Knochen. Dann freilich hätte man es statt „Brandopfern von Füßen“ eher mit Grillabfällen zu tun; wenngleich die Nahrungszubereitung angesichts der exponierten Örtlichkeit kaum ohne religiösen Kontext denkbar erscheint.
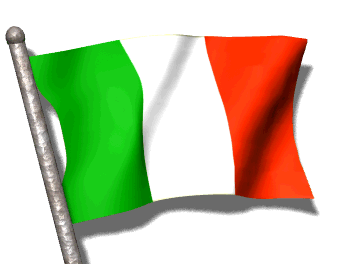 [ITALIANO]
[ITALIANO]
Massiccio dello Sciliar
Il Massiccio dello Sciliar (in tedesco Schlern, in ladino Scilier) è uno dei più caratteristici gruppi delle Dolomiti. Si estende in Trentino-Alto Adige nella provincia di Bolzano e tocca verso est laprovincia di Trento.
Caratteristiche
La sua sagoma costituisce uno dei profili più conosciuti dell'Alto Adige.
Situato al centro del Parco naturale dello Sciliar, è di facile accesso, per gli amanti del trekking, dalla Val di Tires, da Siusi e da Fiè allo Sciliar e, soprattutto, dall'Alpe di Siusi.
Sul pianoro sommitale sorge il Rifugio Bolzano (a quota 2.457 m), da cui si può ammirare un magnifico ed ampio panorama.
Ruotando in senso orario i limiti geografici sono: Valle Isarco, Forcella Denti di Terra Rossa, Passo Alpe di Tires, Val di Tires, Valle Isarco.
Storia
L'archeologia recentemente è riuscita a stabilire, grazie a ricerche mirate e analisi dei pollini, che il vasto altipiano della montagna è già stata utilizzato in modo estensivo nell Età del bronzo, sia per funzioni di culto sia per il pascolo d'alta montagna.
Giovedì 11 agosto 2011 due frane si sono staccate dalla cima Euringer (2934 m) facente parte del massiccio dello Sciliar. La prima verso le 8.30 ha portato a valle 3 massi di grandi dimensioni e la seconda verso le 10.30 ha avuto dimensioni maggiori. In totale il materiale staccatosi è stato quantificato in circa 2000 metri cubi di roccia
Toponimo
Il nome tradizionale della montagna è attestato nel XVI secolo come Schlernkhofl, nel 1567 come auf dem Schalern e nel 1700 come Schlern e ha una base pretedesca e preromana, da identificare in *sala, ovvero "fossato, rio, canale", che si riferisce in primis a Schlerngraben (fossato dello Sciliar) e Schlernbach (torrente). La forma italiana, introdotta da Ettore Tolomei, ricalca la denominazione ladina diSchiliáar.
 [ENGLISH]
[ENGLISH]
Schlern
The Schlern (Italian: Sciliar, Ladin: Sciliër) (2,563 m) is a mountain of the Dolomites in South Tyrol, Italy. The peak at the north west end of the mountain (left, in the image at right) was first ascended in July 1880 by Johann Santner. It is named the Santner Spitze in his honour.
The Schlern dominates the villages of Seis am Schlern and Völs am Schlern, and the summit can be reached following the circular route marked with the number 1 from both villages.
At 1,700 metres (5,577 ft), there is the Schlernboden inn and on the summit plateau is the Schlernhaus inn 2,457 metres (8,061 ft), both open from 1 June to 15 October.
The Schlern is sung of in the Bozner Bergsteigerlied as one of South Tyrol's landmarks. Its characteristic profile appears on the Der Schlern - Zeitschrift für Südtiroler Landeskunde (Magazine forSouth Tyrolean Regional Studies) and the logo pressed into Loacker's wafer biscuits.